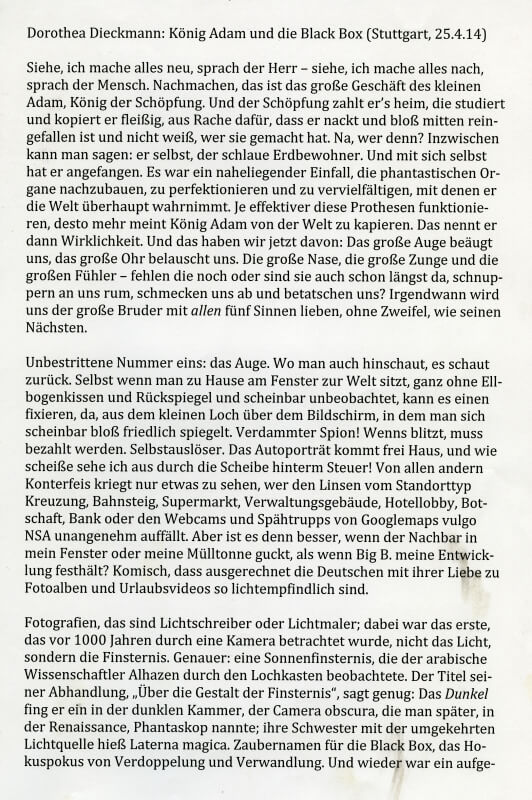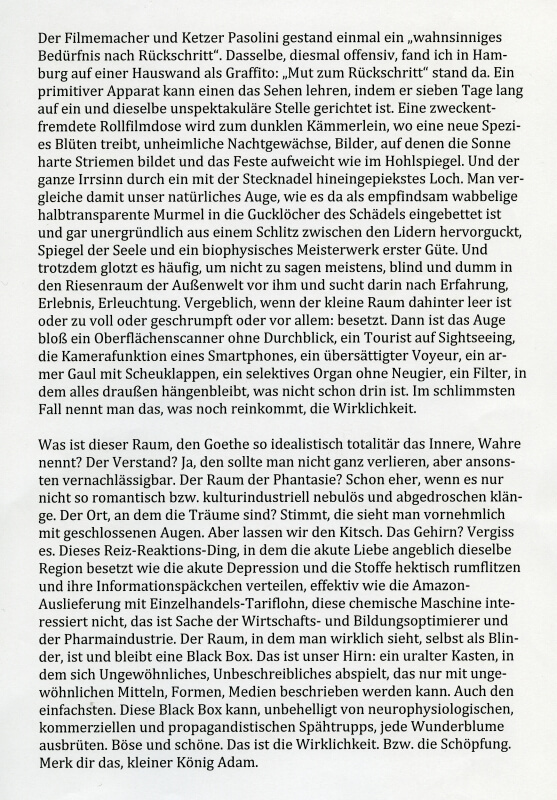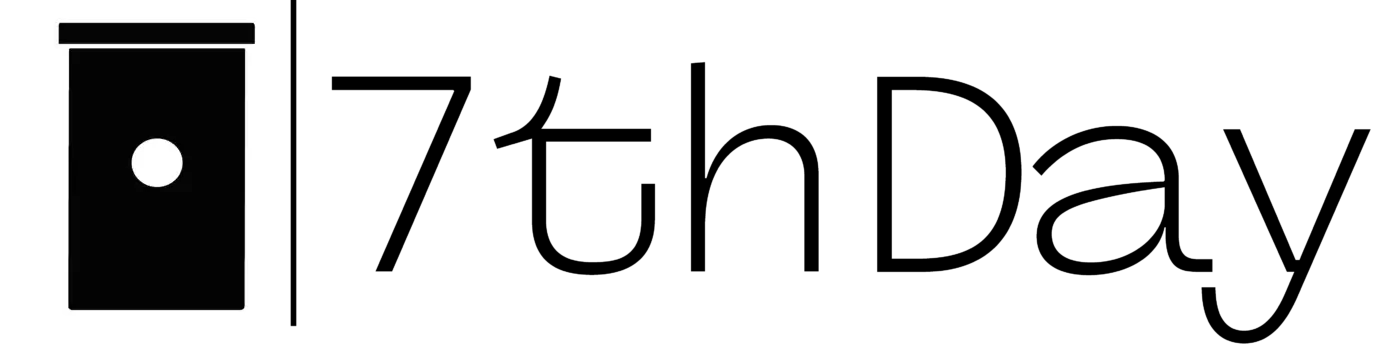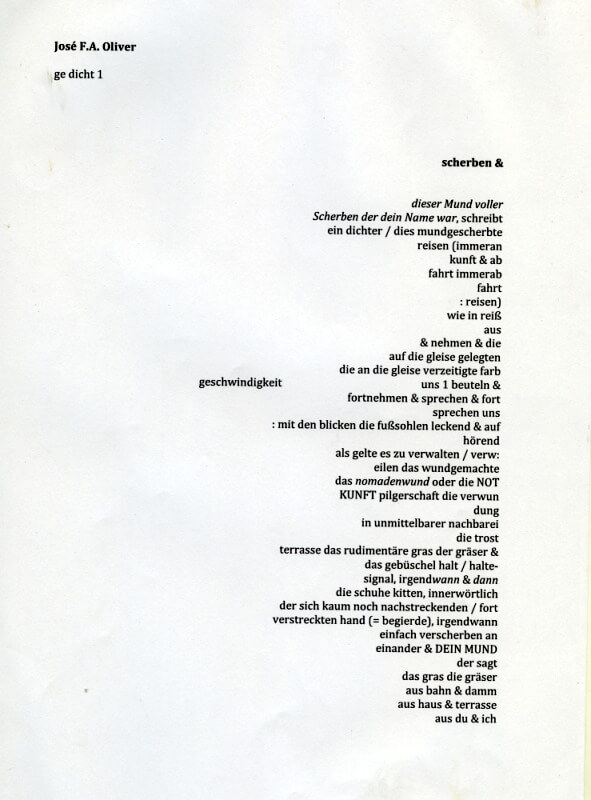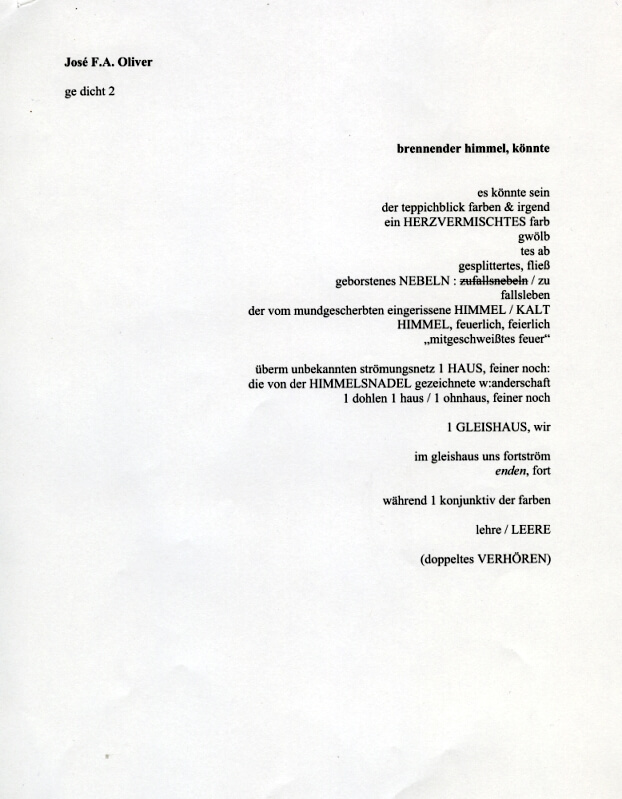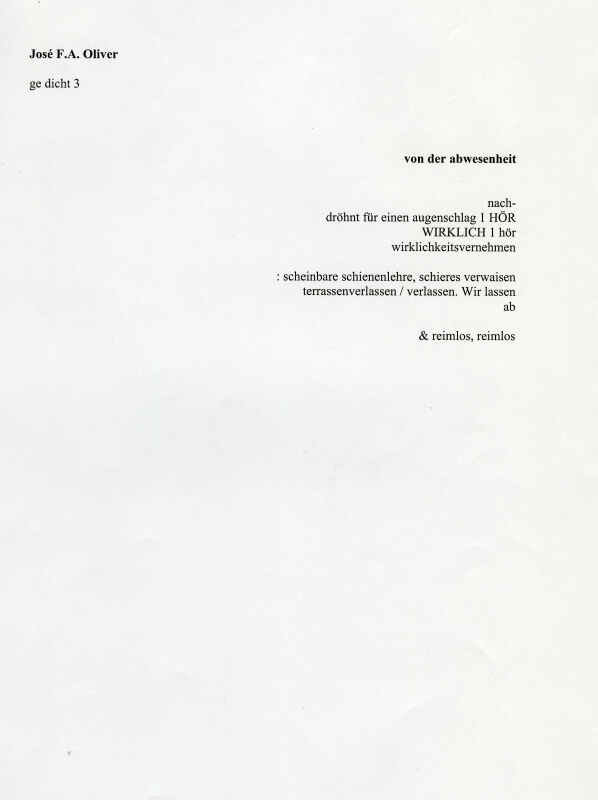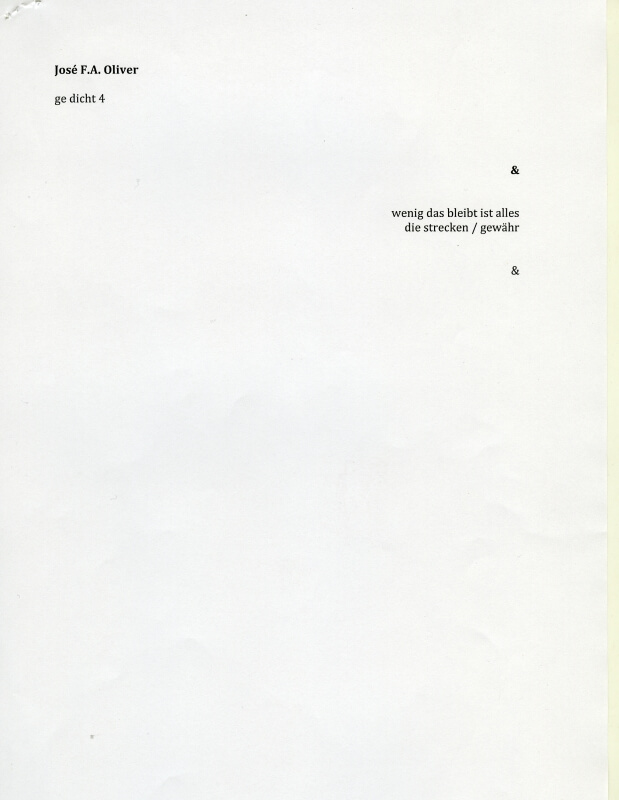Camera Obscura im Literaturhaus Stuttgart „Vermessung der Zeit“
Heinrich Steinfest, Dorothea Dieckmann, José F. A. Olive
Die Ausstellung „Camera Obscura – Vermessung der Zeit“ im Literaturhaus Stuttgart vereinte Fotokunst, Literatur und Musik zu einem außergewöhnlichen Abend. Der in Polen geborene und in Stuttgart lebende Licht- und Fotokünstler Przemek Zajfert stellte seine partizipativen Kunstprojekte mit der Lochkamera vor.
Die Grundlage seiner Arbeiten ist eine einfache, aber faszinierende Technik: die Camera Obscura. Mit einem kleinen Loch und lichtempfindlichem Fotopapier lassen sich Bilder ganz ohne Labor entwickeln – eine Methode, die bis auf Joseph Nicéphore Niépce, den Erfinder der Fotografie, zurückgeht. Durch das Prinzip der Langzeitbelichtung entstehen eindrucksvolle Bilder, auf denen Gebäude, Landschaften und Objekte klar erkennbar sind, während Menschen und Tiere zu flüchtigen Schemen werden.
Literatur trifft Lochkamera




Zur Vernissage beteiligten sich drei bekannte Schriftsteller:innen, die ihr eigenes „obskures Auge“ auf Stuttgart richteten:
- Heinrich Steinfest
- Dorothea Dieckmann
- José F. A. Oliver
Sie erhielten jeweils eine Lochkamera aus Zajferts Atelier, platzierten sie an Orten ihrer Wahl und machten damit eigene Aufnahmen. Die Ergebnisse stellten sie zusammen mit eigens verfassten literarischen Texten vor. So verbanden sich Fotografie und Sprache zu einer gemeinsamen künstlerischen Reflexion über Zeit, Erinnerung und Wahrnehmung.
Ein Blick in die Ausstellung
Die Ausstellung zeigte nicht nur die Arbeiten der Autor:innen, sondern auch eine große Auswahl aus Zajferts weltweitem Projektarchiv. Menschen aus vielen Ländern hatten eine seiner Lochkameras erworben, selbst Aufnahmen gemacht und diese an den Künstler zurückgeschickt. Entstanden ist ein digitales Archiv, das individuelle Blickwinkel, Stadtansichten und persönliche Geschichten in überlagernden Zeitschichten dokumentiert.
Heinrich Steinfest

Blow In von Heinrich Steinfest
Was ist das überhaupt: ein Foto? Gefrorene Wirklichkeit? Die auftaut, sobald wir sie betrachten? Die warm wird, zu tropfen anfängt, dampft? Aufgewärmt von unserer eigenen Erinnerung an das Geschehene? Es geht auch umgekehrt. Meine frühesten Erinnerungen an mein Leben sind schwarzweiß. Ganz früh, aus Babyzeiten. Ganz einfach darum, weil sie von Fotos stammen, die ich später – vielleicht als Vier- oder Fünfjähriger — im Familienalbum sah und sich daraus dann eine Erinnerung an meine ersten beiden Lebensjahre in Australien, wo ich geboren wurde, formte. Da wären: ein mannshoher Kaktus; Kinder um einen Tisch, die mich, der ich auf dem Schoß einer Kindergärtnerin sitze, interessiert anschauen; ein tief ins Flußbett geschnittenes Gewässers. Dieses Kaktusfoto, dieses Kindergartenbild, dieser Anblick eines durch karge Landschaft fließenden Stroms haben sich mir eingebrannt. Fotos in meinem Kopf. Als ich die kleine schwarze Plastikdose aus dem Atelier Zajfen erhielt, zusammen mit der Aufforderung, sie an einem Stuttgart Ort meiner Wahl zu plazieren und durch Herunterziehen des Klebestreifens die Belichtung und damit die Aufnahme zu starten, erinnerte mich dies wiederum daran, als ich das erste Mal in meinem Leben mir Gedanken über die Musik machte, die aus dem Radiogerat unseres Wohnzimmers drang. Immer wieder schob ich damals das Gerät ein Stück nach vor, um auf der mit winzigen Löchern ausgestatteten Rückseite in das beleuchtete Innere des Radios zu schauen. Ich war nämlich überzeugt, es würde sich darin eine Gruppe sehr kleiner Musiker befinden, die auf ihren winzigen Instrumenten diverse Lieder — Songs, denn bei uns lief der Popsender – produzieren. Ich dachte viel an das Leben dieser Leute, fragte mich, ob sie auch außerhalb des Geräts existieren konnten, woher sie ihr Essen nahmen, fragte mich, wie und ob überhaupt sie ihre Notdurfl verrichteten (etwas, das mich auch später immer wieder bei fiktiven Personen in Film und Literatur beschäftigte) und dachte mir, daß es sich um Leute handelte, die eine große Wärme in dieser Apparatur aushalten mußten. Stellte mir vor, wie sie wohl schwitzten, vor allem bei den schnell gespielten Musikstiicken…
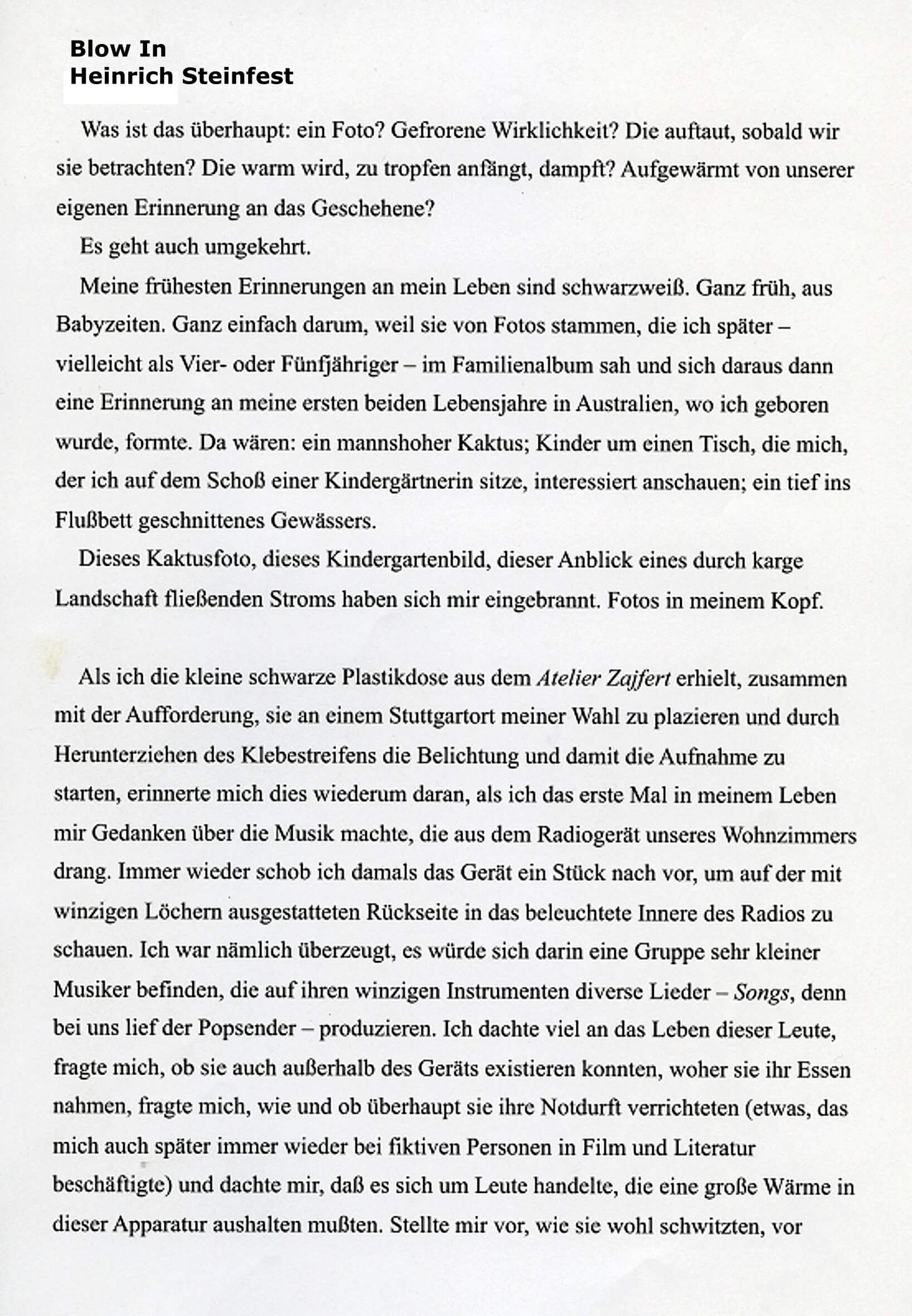
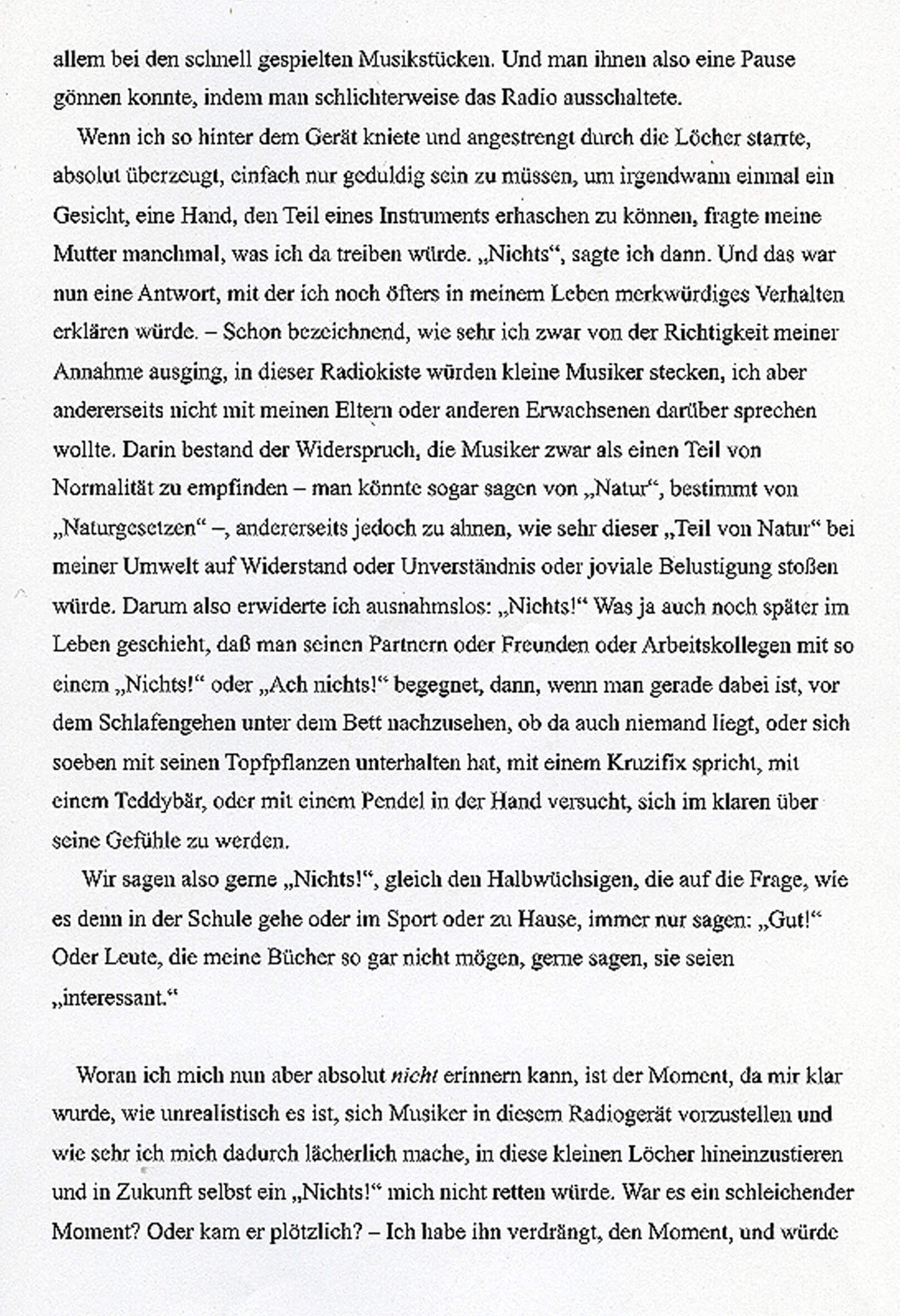

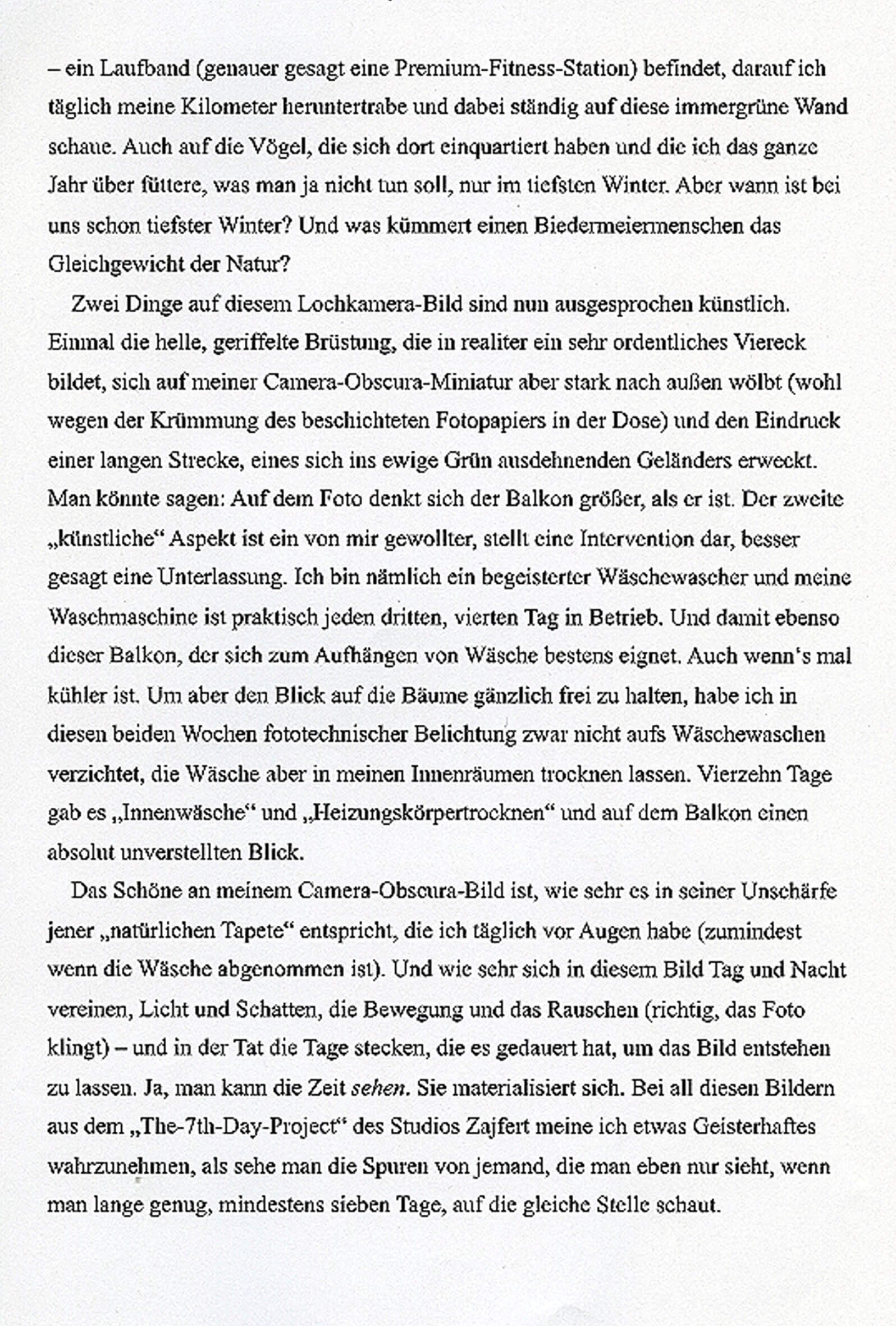
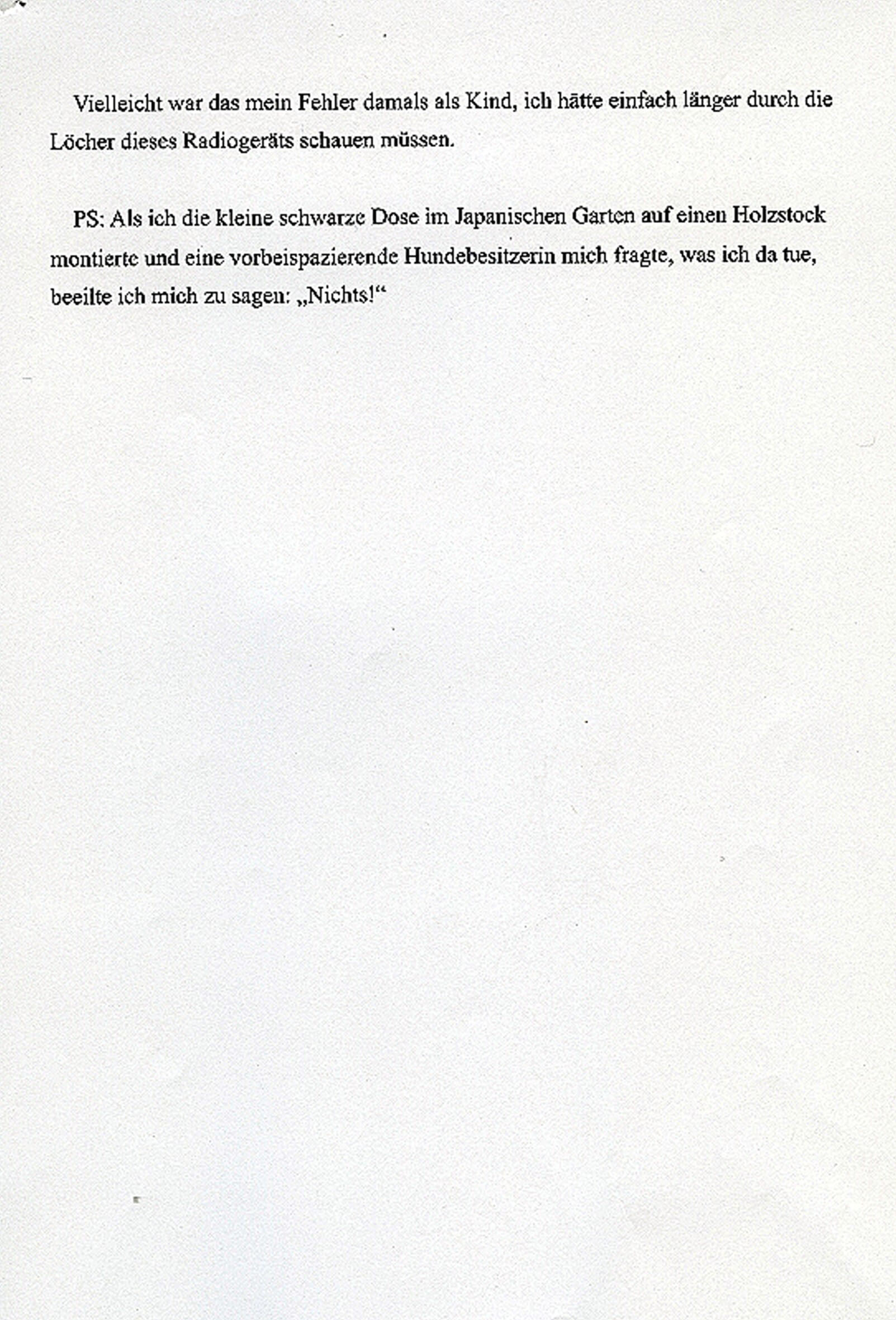
Dorothea Dieckmann

König Adam und die Black Box von Dorothea Dieckmann
Siehe, ich mache alles neu, sprach der Herr – siehe, ich mache alles nach, sprach der Mensch. Nachmachen, das ist das grofle Geschäft des kleinen Adam, König der Schöpfung. Und der Schöpfung zahlt er’s helm, die studiert und kopiert er fleißig. aus Rache dafür, dass er nackt und bloß mitten reingefallen ist und nlcht weiß, wer sie gemacht hat. Na, wer denn? lnzwischen kann man sagen: er selbst, der schlaue Erdbewohner. Und mit sich selbst hat er angefangen. Es war eln naheliegender Einfall, die phantastlschen 0rgane nachzubauen, zu perfektionieren und zu vervielfältigen, mit denen er die Welt überhaupt wahrnimmt. Je effektlver dlese Prothesen funktionieren. desto mehr meint Könlg Adam von der Welt zu kapieren. Das nennt er dann Wirklichkelt. Und das haben wir jetzt davon: Das große Auge beäugt uns, das große 0hr belauscht uns. Dle grofie Nase, die großse Zunge und dle großen Fühler – fehlen dle noch oder sind sie auch schon langst da, schnuppern an uns rum, schmecken uns ab und betatschen uns? lrgendwann wird uns der große Bruder mit allen fünf Sinnen lleben, ohne Zweifel, wie seinen Nächsten…